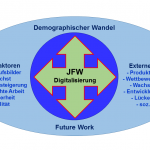Wenn wir von der Arbeitswelt der Zukunft reden, dann sehen wir gerne virtuelle Arbeitsplätze, menschenleere Produktionshallen und eine Work-Life-Balance, die sich eher auf das Life bezieht. Wir reden in diesem Zusammenhang dann auch gerne über die Konnektivität und die multimediale, universelle und ständige Erreichbarkeit von allem und jedem. Und wir reden gerne darüber, dass die neue Generation Schwung in unsere angestaubten Strukturen und Prozesse bringt – neues Leben schlechthin. Mit neuen Ideen, frischen Vorstellungen und mehr Dynamik.
Das sind zumindest die Vorstellungen, über die wir gerne reden. Die wir gerne hören. Aber an die wir nicht wirklich glauben. Glauben können. Denn im Gegensatz zu denen, die glauben, mit entsprechendem Wissen alles das erreichen zu können, gibt es da die Älteren, die bestimmt wissen, dass mit entsprechender Erfahrung, das alles anders aussehen wird. Zum besseren Verständnis: Erfahrung definiert sich als die Summe der Erfolge / Misserfolge auf der Zeitachse, die man überlebt hat. Von denen man also noch lernen konnte…
Und damit sind die ersten Bausteine der Kette, die Erreichbarkeit, Auffindbarkeit und Verifizierbarkeit von Menschen und Unternehmen, aus personaltechnischer Sicht die Grundlage, um sinnvoll multimedial präsent zu sein. Das wird nun gemeinhin den Social Media zugesprochen. Und wer diese nutzt, um finden und kommunizieren zu können, muss sich dort selbst visualisieren. Selbst ein Profil pflegen. Das hat dann Vorteile, aber auch Nachteile, die aus dem geänderten Bewusstsein resultieren, wie wir in diesen Medien auftreten, uns darstellen und WIE wir mit diesen Medien kommunizieren. Und das kann nicht jeder. Und schon gar nicht jeder ist gewillt, das in einem Rahmen zu tun, der darauf schließen lässt, dass er um die inzwischen gesellschaftliche Funktion, die Sichtbarkeit und fast sofortige Verfügbarkeit seiner Äußerungen weiß UND auch noch gewillt ist, sich an die Regeln zu halten, die “Anstand und Sitte” gebieten. Und da ist auch schon das gravierende Problem von Social Media: die mögliche und auch genutzte Anonymität des www zur Selbstdarstellung zu Lasten anderer!
Der Begriff “shit storm”, der schon über viele Unternehmen, sog. VIPs und Meinungsträger hereingebrochen ist, macht deutlich, wie wenig man dagegen tun kann, wenn (oder sobald!) es einen trifft. Diese Hilflosigkeit, gepaart mit der wirtschaftlichen Bedeutung für den Absatz und damit die Umsatzziele, lasse viele Unternehmen eher zurückhaltend im Social Media Bereich agieren. Wenn überhaupt eine aktive Rolle, dann über eine einfach nur hinterlegte Page bei Facebook, Xing & Co, damit man präsent und als state-of-the-art wahrgenommen wird. Auch ist die Pflege der Social Media sehr zeitintensiv und damit kostentreibend. Die Risiken und Kosten überwiegen daher oft den wahrnehmbaren Nutzen. Gerade aus Sicht von konservativen Managern.
Doch welchen Sinn macht es, gegen etwas ankämpfen zu wollen, was sich zunehmend zum reißenden Strom entwickelt. Eben weil junge, dynamische und von diesen Medien geprägte Mitarbeiter und Manager der Generation Y in eben diesen Medien die Zukunft sehen, und das, was konservative Sichtweisen gebieten, als altertümlich und daraus resultierende Folgen gerne als “Anlaufschwierigkeiten” abtun.
Das ist der gleiche Effekt, den wir Anfang der 80er in den Vorstandsetagen sahen, als die Sinnhaftigkeit der flächendeckenden Einführung von IT diskutiert wurde, der damals hohe Anschaffungskosten für Arbeitsplatzrechner und das mangelnde Verständnis ringsum entgegenstanden. Von Qualifikation oft gar nicht zu reden. Das hat damals den Jugendwahn in der Industrie ausgelöst, als Jugendlichkeit oft zum bestimmenden Element bei Besetzungsentscheidungen für Führungspositionen und / oder auch nur Einstellungen genommen wurde und das dann mit “Entwicklungsfähigkeit” bezeichnet wurde. Eine Einstellung, die bis heute anhält und nun, dank gewonnener Erfahrung, von eben diesen Nutznießern so für die Social Media Entwicklung (auch) nicht gesehen wird. Doch das Verständnisproblem sitzt tiefer. Und wir, die Älteren von uns, haben es verursacht.
Wenn wir von den älteren Kollegen reden, reden wir in aller Regel von denen, die den geburtenstarken Jahrgängen angehören. Den Jahrgängen 1960-69, die in aller Regel seit Schulbeginn gegeneinander konkurriert haben. Die bei Stellenausschreibungen die Erfahrung gemacht haben, dass auf eine Stelle zum Teil hunderte Bewerber kamen und Konformität oft zum Schlüssel des Verbleibs in Unternehmen wurde. Gerade in den wiederholt aufgetretenen Zeiten des industriellen Wandels.[1]
Vor dieser Situation, diesem als belastend wahrgenommenen Lebensumstand, haben wir unsere Kinder bewahren wollen. Ihnen mehr Freiheiten gegeben, als wir sie hatten. Oder als unsere Eltern sie hatten, die nach dem Krieg ganz andere Herausforderungen zu stemmen hatten und diese Sichtweisen auf uns prägend übertrugen. Wir wollten und haben unsere Kinder eher behütet aufgezogen. Zum Teil auch bewusst als Einzelkinder mit all dem Aufwand, den man sich nur leisten konnte, wenn man EIN (1) Kind hatte.
Diese Generation hat nun einen Namen: die Generation Y, die Youngster, was nicht umsonst bei dem ein oder anderen wie “Gangster” klingt. Diese Generation schlug erstmals in der Zeit des Internethypes zu und veränderte die Sichtweise der Wirtschaft nachhaltig. Zum Teil auch ihre Wahrnehmung durch ältere Manager und dann durch die Gesellschaft. Die Generation Y wurde erstmals in der Arbeitsgeschichte als eine Gruppe angesehen, der etwas fehlt. Die anders ist. Für die die Strukturen nicht passen, die sie zur Arbeit vorfanden. Kurz: eine Generation, die Probleme macht!
Warum? Weil wir sie dazu erzogen haben!
Sie sollten doch eigene Vorstellungen entwickeln, sich den Tretmühlen industriellen Produktionsverständnisses – individuell, aber jeder für sich und damit dann alle – entziehen. Eigene Werte leben. Keine grauen Mäuse sein. Sich entfalten. Zu Schmetterlingen… Dieser emotionalen, mit netten Metaphern gespickten Prosa fehlt nur noch eines; und dieses Wort heißt: wohlbehütet! Und das meint die Abwesenheit von allzu großer Konkurrenz, die wieder mehr individuelle Entfaltung möglich, die die gesellschaftlichen Zwänge und Anpassung daran zum Teil sogar unnötig machte und damit selbstbewusste Menschen schuf, die aus wirtschaftlichen Gründen eben nicht mehr alles mit sich machen ließen, was früher ohne Probleme möglich war.
Als Eltern sahen wir das mit Freude. Als Vorgesetzte und Verantwortliche für Umsatzzielerreichung und mit der Gesamtpopulation der Generation Y konfrontiert, war das schon nicht mehr so lustig und führte zu der Wahrnehmung, die dann als Generation Y bezeichnet wurde. Ähnlich wurde wohl nur noch die 69er-Bewegung, hier allerdings als gesellschaftlicher Wandel, wahrgenommen. Und exakt diese Bewegung prägte unseren Entschluss unsere Kinder anders zu erziehen… Et voilà!
Und dann die Kinder, die im neuen Jahrtausend geboren wurden, und daher auch nur noch die digitale Welt kennen. Sie werden daher, wie auch schon die Generation Y, als Digital Natives bezeichnet. Nur sie sind es wirklich, da diese Generation, anders als ihre Eltern, gar nichts mehr anderes kennenlernt, als die Medien und Technologien, die wir noch aus Zeiten kennen, wo diese nicht allverfügbar, allgegenwärtig und prägend waren. Und anders als die sinnsuchende Generation Y, sucht diese Generation schon jetzt erkennbar nach Anerkennung an sich; aber auch nur nach anerkannter eigener Außendarstellung.
Vermehrt ist schon jetzt der Wunsch kommuniziert, schnell Führungspositionen erreichen zu wollen. Das aber ohne dem Streben nach materiellen Reichtümern, sondern eher aus dem Bestreben heraus, eine Position mit sozialer Wertschätzung und Wahrnehmung zu erreichen. Dazu sind ihnen Netzwerke extrem wichtig, eben weil sie schon jetzt lernen, sich in ihnen darzustellen, um diese Anerkennung zu erlangen.[2]
Und da schließt sich ein Kreis, der, bei falschem Handling, für Unternehmen doppelt risikowirksam werden könnte. Einerseits ist ohne aktive Kommunikation an den Orten, wo mögliche Talente auffindbar sind, kein den Bedarf deckendes Recruiting mehr möglich, wenn das aufgrund des demographischen Wandels überhaupt noch möglich ist. Andererseits haben wir es in zehn Jahren mit einer Generation zu tun, die man nicht einfach als Profilneurotiker abtun und dann ignorieren kann. Ihre Wünsche nicht zu berücksichtigen, wird vermehrt zu den Problemen führen, die schon jetzt den Umgang mit der Generation Y prägt.
Vielmehr wird hier ein gefährlicher möglicher Konflikt offensichtlich, der gerade durch die Social Media verstärkt wird: Es wird eine Generation nach Führung drängen, die zum Teil ihre Sozialkontakte über das www erfahren hat. Sich dort positioniert hat und Anerkennung sucht. Und diese Generation sucht nun schnell Führungspositionen, nicht um sinnhaft(!) etwas verändern zu wollen oder an einer Story teilzuhaben, wie die Generation Y, sondern um der bloßen Selbstdarstellung, zwecks Anerkennung ihrer selbst willen. Etwas, wo wir uns schwer tun, nicht sofort die Nase zu rümpfen… Eine Horde anerkennungssüchtiger Egomanen will die Führung!
Dazu vier Punkte:
1.) Das ist nun mal so und es ist sinnlos dagegen zu wettern.
“Hadere nicht mit der Welt, denn es stört sie nicht”, sagte schon Marc Aurel.
2.) Die Möglichkeiten der Future Work für diese Generation zu definieren und sie auf Ihre Wünsche hin abzustimmen, wird nun eine Pflichtübung. Das wird in erster Linie eine Managementaufgabe der Generation Y sein, denn sie wird einerseits in zehn Jahren in der Position sein, in der sie die Verantwortung tragen wird, und andererseits widerstrebt die alleinige Anerkennungssuche ihrer dann wohl realisierten Sinnsuche. Aus den Treibenden werden nun selbst Getriebene. Die gesammelte Erfahrung macht es möglich.
3.) Das erfordert schon jetzt eine zielgerichtete Kommunikation, und zwar dort, wo ich Talente suchen kann, will und / oder muss. In den Netzwerken. Den sozialen Medien!
Und daher macht Punkt drei auch deutlich, dass wenn ich von dieser Generation überhaupt auf Augenhöhe der Eigendarstellung als Unternehmen wahrgenommen werden will – und nur so ist das Interesse bei ihnen zu wecken, überhaupt bei mir anfangen zu wollen – ich eben die Regeln dieses Wandels im www mitvollziehen muss. Doch wenn ich das als Unternehmen will, brauche ich eine glaubhafte Corporate Identity. Kein nettes Corporate Design, an dem man gerne mal dreht um sich aufzufrischen, sondern einen klare, kommunizierbare und wahrhaftige Corporate Culture als Basis des dann gelebten Miteinanders.[3]
Und dieses Miteinander muss dann zwei Aspekte ganz deutlich umfassen: es muss einerseits Raum, Möglichkeit und Zeit bieten, dass sich diese Generation Anerkennung sinnbringend erarbeiten kann, ohne an ihre Belastungsgrenze zu kommen, da diese in konkurrenzlosen Umgebungen eher abgenommen hat und der Durchhaltewille oft nur durch ständiges Lob gefördert werden kann. Hier von Konfliktfähigkeit wie wir sie kennen zu reden, wäre viel zu oft zu hoch gegriffen. Vielmehr hat die oft schon kritisierte und weit verbreitete Kuschelpädagogik dazu geführt, dass Ziele zu schnell gewechselt werden, wenn es zu ersten Umsetzungsschwierigkeiten kommt. Daher müssen die dann vor Ort überwiegenden älteren Mitarbeiter und Vorgesetzte mit Sicherheit neue Verhaltensmuster entwickeln. Das wird nicht ohne absehbare Konflikte abgehen. Dennoch wird es richtig sein, solche “Freiräume” zu bieten. Sogar zu fördern. Aber halt auch mit dem nötigen Nachdruck Leistungen einzufordern.
Andererseits muss diese Art der geförderten und gelebten Anerkennungskultur dann auch umfassend kommuniziert werden. Mit all den daraus resultierenden Höhen und Tiefen der Wahrnehmung von außen. Wer sich darstellt, macht sich angreifbar. Oder zumindest bewertbar. Und das setzt Mechanismen und Methoden voraus, wie ich mit was und ggf. auch mit wem ich dann gegen Argumente aus dem Netz verfahre. Abducken und stillhalten wird in einem solchen Umfeld als Schwäche wahrgenommen, in der man auf keinen Fall Anerkennung erlangen kann. Schließlich soll auch das Unternehmen in einer solchen Sichtweise die Plattform sein, die es der Generation Z ermöglicht, sich zu präsentieren. Ihre Erfolge zu visualisieren. Unternehmen, die das für sich selbst können, sind in dieser Wahrnehmung auch gut für mich, das Talent. Und das fördert die Wahrnehmung durch andere, die sich auch so “gefördert” sehen wollen.
Und das kann ganz einfach sein: Man kommuniziert besonders gute Leistungen von Mitarbeitern und Azubis, wie Patente, Jugend forscht oder Berufswettkämpfen. Ihre Teilnahme / Erfolge an hochrangigen (regionalen) Sportveranstaltungen. Oder ihr Engagement für außerberufliche Aktivitäten wie beispielsweise die freiwillige Feuerwehr (das wäre sogar infrastrukturfördernd für den Standort), Sanitätsdienste oder Pfadfinder.
Auch wenn das nun klingt wie das neue Samaritertum schlechthin, soll es nur Beispiele aufzeigen, wie kommunizierbare und visualisierbare Win-Win-Situationen entstehen können. Für das Unternehmen, die Mitarbeiter und den sie umgebenden gesellschaftlichen (regionalen) ganzheitlichen Rahmen: den Standort, ohne den es auch nicht gehen wird.[4]
“Tue Gutes und REDE darüber!”, ist ein alter Spruch, der in der PR einen hohen Stellenwert hat. Nicht umsonst. Nur in Zeiten der Social Media ist das Reden darüber quasi sofort kommentierbar, bewertbar und auch anfeindbar. Denn, anders als bei Printmedien, ist es sehr einfach, sich hier zu äußern. Auch fehlt der große Aufwand, das sofort tun zu können, wie mit Leserbriefen. Im Gegenteil: Social Media laden per bereitgestellter Schnittstelle geradezu ein, eben das zu tun und dann zu TEILEN! – Mit all seinen Freunden und Bekannten und auch völlig Fremden, die das auch lesen, kommentieren können und ggf. auch gerne weiterverbreiten helfen. Und das nicht just in time sondern schlimmer: live!
Unsinn, Propaganda und Unwahrheiten zu verbreiten ist in Zeiten von Twitter & Co nicht mehr möglich. Auch endet das Unternehmen nicht mehr am Zaun und kommuniziert nur das, was die PR-Abteilung abgesegnet hat. Arbeitgeberbewertungen werden online von Netzwerken abgefragt. Teilweise schon fast abgenötigt. Datenbanken werden durchforstet, aufbereitet und dann den Unternehmensprofilen sinngebend hinzugefügt. Mit Daten zu Nationalitäten, Genderverteilungen, (vom User bekannten) Mitarbeitern im Netzwerk und das alles schön demographisch aufgeschlüsselt. Und nein, seine Mitarbeiter da raushalten zu wollen wird zunehmend schwieriger. Auch arbeitsrechtlich.
Fazit:
Social Media kommen nicht in die Unternehmenskommunikation; sie sind schon da! Nur bei manchen noch nicht angekommen. Ob bewusst oder gar gewollt.
Netzwerke sind für kommende Berufsgenerationen hinsichtlich der Konnektivität lebenswichtig und daher nicht mehr wegzudenken. Daher ist es wenig vorteilhaft, sich wie der Vogel Strauß zu verhalten und den Kopf in den Sand zu stecken. Es macht es nur einfach, ihn zu fressen. Und exakt das macht der Markt, hier der Personalmarkt, mit Unternehmen, die es nicht schaffen, mit ihren Mitarbeitern, möglichen Talenten, den Kunden und ihrer sozialen Umwelt auf Augenhöhe zu kommunizieren. Nicht nur von der Wertschätzung her, sondern hier vor allem mit den gleichen Medien.
Die Corporate Identity 2.0, die ganzheitlich Marketing und HRM berücksichtigt, ist hier als Bindeglied und tragfähiger Rahmen wichtig, von und aus der heraus eine Kommunikation über soziale Netzwerke erst erfolgversprechend und dann auch sinngebend ist. Sinngebend für eine in zehn Jahren auf den Markt drängende Generation, die öffentlich wahrnehmbare Anerkennung sucht. Eine Generation Y, die dann in der Verantwortung steht ihre Erfahrungen mit der sinnhaften persönlichen Berufsentwicklung in Einklang zu bringen mit den Ansicht der ihr dann folgenden Generation Z. Und das in Ganzheitlichkeit zu denen, die dann mehrheitlich noch im Unternehmen stehen und immer länger arbeiten müssen. Denen, die nie gefragt wurden, ob ihre Beschäftigung für sie sinnbringend war, oder ob sie auch Anerkennung dafür erhielten. Sie prägten zwei Generationen. Gaben ihnen den Raum, den sie nutzen, um sich zu dem zu entwickeln, was nun als Generation Y und Generation Z bezeichnet wird.
Social Media sind eine Erfindung der Generation Y. Ebenso wie das digitale Netzwerken. Daher wird sich die Frage stellen lassen müssen, wie sie gedenkt, sinnhaft und anerkennend mit denen umzugehen, die ihnen all das ermöglicht haben und denen, denen die Sinnhaftigkeit der eigenen Anerkennung womöglich wichtiger ist, als eine gemeinsame (Unternehmens- und Wirtschafts-)Entwicklung.
Social Media mit der Büchse der Pandora vergleichen zu wollen, wäre mit Sicherheit falsch, denn es ist kein Übel über die Welt gekommen, aber eines ist sicher:
Die Büchse ist auf und lässt sich nicht mehr schließen!
Quellenverzeichnis:
[1] Rauschenberger, Sascha (2014): “Demografischer Wandel und Future Work: Eine gesellschaftliche Herausforderung für den Arbeitsmarkt der Zukunft” (Conplore)
[2] Vgl.: Scholz,Christian: “Generation Z: Willkommen in der Arbeitswelt” in: Der Standard, 6. Januar 2012
[3] Rauschenberger, Sascha (2014): “Future Work und Megatrends: Herausforderungen und Lösungsansätze für die Arbeitswelt der Zukunft – Ein Kompendium zum demographischen Wandel”, Kapitel 5 “Future Work und Corporate Identity” (Windsor-Verlag)
[4] Rauschenberger, Sascha (2014): “Megatrends und Future Work: Teil 3 – Herausforderungen an Kommunen, Kammern und Verbände für die Arbeitswelt der Zukunft” (Conplore)