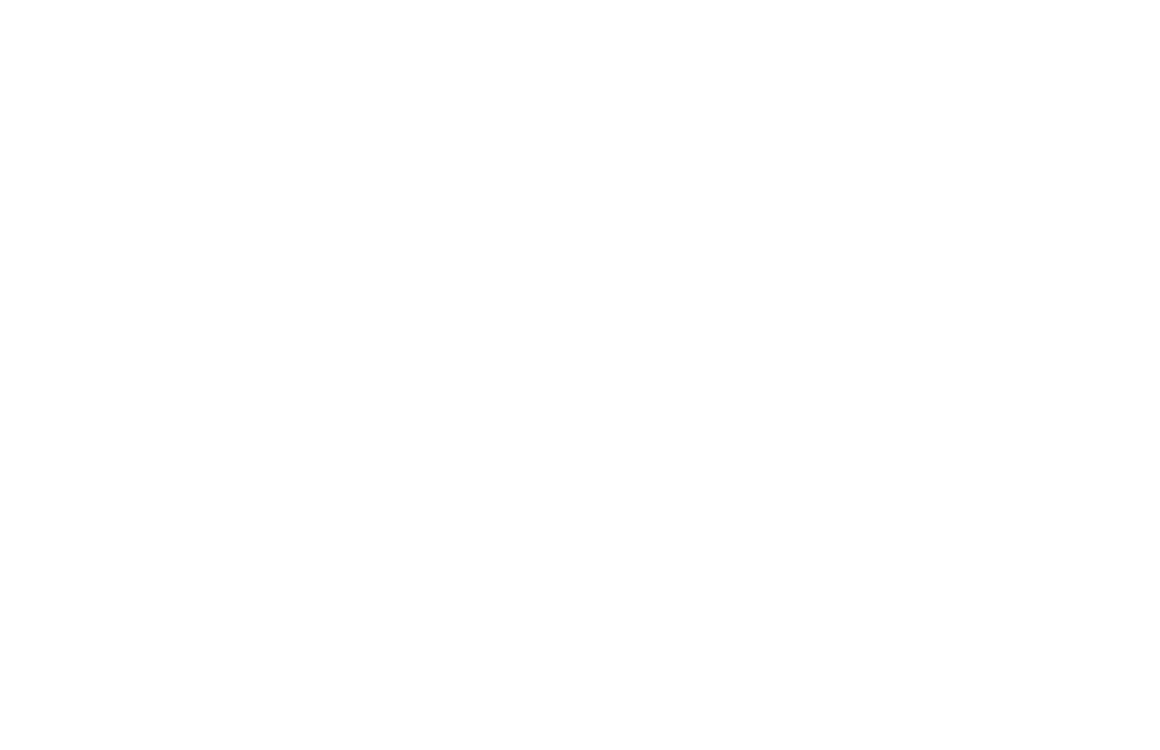Artikel über Privatinsolvenz-Dauer teilen!
Privatinsolvenz: Mit welcher Dauer müssen Schuldner rechnen?
Können eigene Verbindlichkeiten absehbar nicht mehr beglichen werden, bleibt Verbrauchern der Weg in die Privatinsolvenz. Sie soll einen wirtschaftlichen Neuanfang ermöglichen. In den letzten Jahren wurden die Rahmenbedingungen und Anforderungen der Privatinsolvenz verändert.
Obwohl die Privatinsolvenz in einem recht kurzen Zeitfenster Schuldenfreiheit verspricht, geht sie mit gewissen Einschränkungen einher. Sie sollte daher nur dann gewählt werden, wenn ein anderer Ausweg nicht möglich ist. Bevor eine Privatinsolvenz angemeldet wird, sollten sich Schuldner unbedingt von einem Schuldnerberater oder einem Rechtsanwalt beraten lassen.
1999 wurde in Deutschland die Möglichkeit der Privatinsolvenz, offiziell Verbraucherinsolvenz, eingeführt. Der Anteil der überschuldeten Menschen, die diese Option nutzen, ist gering und liegt gerade einmal bei rund einem Prozent. Dabei ist eine Privatinsolvenz durchaus eine attraktive Aussicht auf einen möglichen Neustart. Am Ende der Insolvenz steht immerhin die Schuldenfreiheit. Um den Anteil der Menschen zu steigern, die die Verbraucherinsolvenz nutzen, wurde das Verfahren in den letzten Jahren immer wieder reformiert. Dabei wurden die Reformen generell zugunsten der Verbraucher gestaltet.
Kürzere Verfahrensdauer soll Privatinsolvenz attraktiver machen
Im Rahmen einer der letzten Reformen hat man sich dazu entschlossen, die Verfahrensdauer deutlich zu reduzieren. Lag diese ursprünglich bei sechs Jahren, müssen sich Schuldner nun nur noch drei Jahre lang auf Einschränkungen einstellen.
“Dieses Zeitfenster ist als Restschuldbefreiung bekannt.“
Wer die Wohlverhaltensphase hinter sich hat, erhält eine Restschuldbefreiung. Alle Schulden sind in diesem Fall nichtig und es kann wirtschaftlich ein Neustart erfolgen.
Privatinsolvenz kommt für die meisten Bürger infrage
Die Verbraucherinsolvenz steht einem Großteil der Bürger offen. Berechtigt dazu sind Arbeitnehmer, aber auch Rentner und Empfänger von Arbeitslosengeld oder Bürgergeld.
“Selbstständigen dagegen steht der Weg in die Privatinsolvenz nicht zur Verfügung.“
Sie müssen auf die Regelinsolvenz ausweichen. In diesem Fall beträgt aber die Dauer für die Restschuldbefreiung auch nur drei Jahre. Wer dagegen einmal selbstständig war und jetzt nicht mehr als 19 Gläubiger hat, kann wiederum die Privatinsolvenz nutzen. Wichtig ist dann aber, dass keinerlei Schulden vorliegen, die sich aus der ehemaligen Beschäftigung von Arbeitnehmern in dem eigenen Unternehmen ergeben.
Der Weg in die Privatinsolvenz: die ersten Schritte
Die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland ist in den letzten Jahren recht stabil. Ausgenommen von kurzfristigen Nachholeffekten hat auch die kürzere Wohlverhaltensphase nicht zu mehr Insolvenz bei den Verbrauchern beigetragen. Dabei ist die Privatinsolvenz eine gute Möglichkeit, um sich von einer Überschuldung zu befreien.
“Um die Verbraucherinsolvenz in Anspruch nehmen zu können, müssen Betroffene zunächst eine der Schuldnerberatungsstellen aufsuchen oder sich mit einer Anwaltskanzlei in Verbindung setzen, die sich auf Insolvenzrecht spezialisiert hat.“
Eine weitere Anlaufstelle kann eine Schuldnerberatungsstelle sein. Ziel dieser ersten Kontaktaufnahme ist es, zu klären, ob für die betroffenen Verbraucher ein solches Verfahren überhaupt infrage kommt. Weiterhin werden sie bereits umfassend aufgeklärt, welche Einschränkungen und Rahmenbedingungen mit der Privatinsolvenz einhergehen.
Damit eine unabhängige Beratung möglich ist, müssen Verbraucher hier von Anfang an die gesamte Schuldensituation offenlegen. Es ist also ein offener Umgang mit den eigenen Verbindlichkeiten besonders wichtig.
Was passiert bei dem außergerichtlichen Einigungsversuch?
Bevor die Privatinsolvenz eröffnet wird, muss ein außergerichtlicher Einigungsversuch vorgenommen werden. Hier erfahren Schuldner umfassende Unterstützung durch die Beratungsstellen. Dieser Versuch bleibt meistens erfolglos.
“Erst wenn eine außergerichtliche Einigung gescheitert ist, kann bei dem zuständigen Gericht der Antrag auf die Privatinsolvenz gestellt werden.“
Wichtig ist, dass hier auch eine Stundung der Verfahrenskosten beantragt wird. Diese sind mit durchschnittlich 2.500 Euro recht hoch. Nach Bestellung des Treuhänders beginnt schließlich die Wohlverhaltensphase.
Wie viel Geld steht in der Wohlverhaltensphase zur Verfügung?
Der Schuldner hat in der Wohlverhaltensphase nur einen Teil seines Einkommens zur freien Verfügung. Hierbei handelt es sich um die Summe, die nicht pfändbar ist. Der Teil, der dagegen gepfändet wird, geht direkt an den Treuhänder. Generell wird der Arbeitgeber über die Insolvenz informiert, da er diesen Teil des Einkommens nicht auszahlen darf.
Die Summe des verfügbaren Geldes variiert von Fall zu Fall. Möchten sich Verbraucher hier vorab informieren, kann auf einen der Pfändungsrechner zurückgegriffen werden. Alleinerziehende haben einen Freibetrag von etwa 1.410 Euro zur Verfügung. Generell ist die verfügbare Summe auch immer von dem Einkommen des Schuldners abhängig. Der Freibetrag kann also auch deutlich umfassender sein.
Pflichten während der Wohlverhaltensphase
Fälschlicherweise wird oft angenommen, dass Schuldner lediglich einen Teil des Einkommens abgeben müssen. In der Wohlverhaltensphase werden sie aber mit verschiedenen Verpflichtungen konfrontiert, die sie erfüllen müssen. Abgesehen von der Abgabe eines Einkommensteils müssen die Schuldner beispielsweise jede Arbeit ausüben, die zumutbar ist. Arbeitssuchende müssen außerdem nachweisen, dass sie sich ernsthaft um eine neue Anstellung bemühen.
“Wer kein neues Beschäftigungsverhältnis findet, kann sich generell auch für den Weg in die Selbständigkeit entscheiden.“
Auch hier müssen dann aber entsprechende Zahlungen an den Treuhänder geleistet werden. Wer in der Wohlverhaltensphase eine Erbschaft oder Schenkung erhält, muss die Hälfte davon an den Treuhänder abgeben. Weiterhin dürfen Schuldner kein Vermögen verschwenden und müssen von neuen Verbindlichkeiten, die vorgesehen sind, absehen.
Wer seinen Pflichten nicht nachkommt, geht das Risiko ein, dass die Restschuldbefreiung entfällt.
Besonderheiten zur Dauer der Wohlverhaltensphase
Aktuell beträgt die Wohlverhaltensphase bei der Privatinsolvenz drei Jahre. Dies gilt für alle Insolvenzen, die ab dem 1.10.2020 beantragt wurden. Für alle Restschuldbefreiungsverfahren, für die Anträge zwischen dem 17.12.2019 und dem 30.09.2020 eingegangen sind, gilt an sich auch weiterhin eine Dauer von sechs Jahren, allerdings wird diese automatisch um einzelne Monate verkürzt.
Alle früher beantragten Insolvenzen haben eine Wohlverhaltensphase von insgesamt sechs Jahren. Eine Verkürzung auf drei Jahre ist nur möglich, wenn einerseits die Verfahrenskosten durch den Schuldner beglichen wurden und er andererseits für 35 Prozent der Forderungssumme aufgekommen ist.
Konnte der Schuldner stattdessen bislang nur die Verfahrenskosten begleiten, erfolgt die Restschuldbefreiung immerhin noch nach fünf Jahren.
“Ist die Wohlverhaltensphase abgeschlossen und ist der Schuldner seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachgekommen, spricht ihm das Gericht die Restschuldbefreiung zu.“
Wichtig ist, dass der Antrag auf die Restschuldbefreiung schon mit dem auf das Insolvenzverfahren eingeht oder unverzüglich nachgeholt wird. Es ist durchaus möglich, dass die Restschuldbefreiung entfällt. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Schuldner in den letzten fünf Jahren ein rechtskräftiges Urteil infolge einer Insolvenzstraftat erhalten hat. Mit der erteilten Restschuldbefreiung steht einem wirtschaftlichen Neustart nichts mehr im Weg.
Quellen:
- https://www.schuldnerberatung.de/wohlverhaltensphase/
- https://finanztip.de/privatinsolvenz/
- https://www.deutschlandfunk.de/privatinsolvenz-schuldenfrei-nach-drei-jahren-100.html
- https://www.adn-schuldnerberatung.de/leistungen/privatinsolvenz/faq-privatinsolvenz/
- https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden-insolvenz/privatinsolvenz-in-3-jahren-schuldenfrei-11417
Titelbild: Matthias Koll (Pixabay)
GESETZLICH VORGESCHRIEBENER WARNHINWEIS
Bitte beachten Sie den Hinweis entsprechend § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz: Der Erwerb von auf dieser Webseite genannten Vermögensanlagen kann mit erheblichen Risiken verbunden sein und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. CONPLORE.COM | Matthias Buchholz ist nicht Anbieter dieser Vermögensanlagen, sondern gibt den Anbietern der Vermögensanlagen die Möglichkeit, diese über die von Matthias Buchholz betriebene Webseite www.conplore.com bekannt zu machen oder zu vertreiben. Diese Webseite ist keine Aufforderung und enthält keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung von Vermögensanlagen oder zum Abschluss eines Vertrages über Vermögensanlagen. Die Webseite richtet sich an ein internationales Publikum.
ARTIKEL IST KEINE RECHTSBERATUNG
Die Webseite stellt keine Beratung, Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Kaufaufforderung oder sonstige Empfehlung dar – es handelt sich um Werbung. Ob die in auf dieser Webseite genannten Informationen, Anlagemöglichkeiten, Finanzinstrumente, Tools, Methoden, Anbieter und Instrumente in Ihrem Land rechtskonform (nutzbar) sind und ob sie mit Risiken (z.B. finanziellen oder technischen) – verbunden sind, obliegt Ihrer tagesaktuellen, eigenständigen Prüfung. Geldanlagen und Investitionen können mit Risiken bis hin zum Totalausfall verbunden sein. Für Folgen und Entscheidungen, die aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen, und für die Qualität und Aktualität der Angaben, übernimmt der Betreiber dieser Webseite keine Verantwortung, Garantien und Haftung.