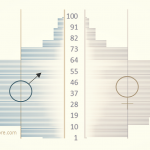JOINT FUTURE WORK[1]
Harte Realitäten als Benchmark für moderne Visionen
Wenn wir über die Zukunft reden, dann denken wir meist daran, dass alles besser werden wird. Schöner, vielfältiger, interessanter und insgesamt lebensfreundlicher. Utopien und Visionen gehen daher gern Hand in Hand.
Da auch die Friedfertigkeit und Freundlichkeit dazugehören, gehört es sich einfach nicht, dort auch einmal einen Riegel vorzuschieben und ein wenig Realität einzufordern. Und Kritik ist wie ein Angriff an sich: er gehört sich in friedlichen Umgebungen einfach nicht. Letzteres ist etwas, „das geht gar nicht“ und es stört das (Befindlichkeits-/Gesellschafts- aber auch Betriebs-) Klima… Und hier beginnen die Probleme. Probleme – nicht Herausforderungen!
Der Soziologe Ralf Dahrendorf sagte einmal, dass Veränderung und Fortschritt nur da gedeihen können, wo auch Konflikte tatsächlich ausgetragen werden.
Und das geht nur, indem es auch unterschiedliche Positionen gibt, die „streithaft vertreten werden“. Diese Streithaftigkeit setzt Aufrichtigkeit und den Willen voraus, sich im Dialog durchzusetzen: Auch bei der Gefahr anzuecken. Anecken zu dürfen, wenn es um Dinge für die (Unternehmens-) Gemeinschaft geht.
Letzteres ist in konfliktbereinigten, stromlinienförmigen und angepassten Umgebungen aber selten zu beobachten. Wenn wir ehrlich sind, wird es gern gesehen, wenn andere es tun und man hinterher auch darüber reden kann, dass das eigentlich richtig war; auch wenn er/sie dann letztlich scheitert(e). Scheitern musste, weil allzu große Veränderungsideen – Visionen – nicht gern gesehen sind, solange sie nicht von ganz Oben kommen.
Doch ohne eine offene Diskussion weiter unten und in der Mitte kann es dann vorkommen, dass diese Visionen von ganz oben schlicht und einfach an dem scheitern, was gelebte Realität ist. Nicht weil hinter der Vision nicht ein guter Wille war, sondern sie scheitert an der Komplexität der Dinge, die ohne Diskussion, Auseinandersetzung und Disput als Input nie Oben angekommen sind…
Hier zeigt sich, dass der fehlende Austausch von Argumenten, Ansichten und Einwürfen letztlich mit dafür verantwortlich ist, dass Visionen scheitern. Also nicht unbedingt „die da oben“ schuld sind, sondern auch alles was unterhalb davon in Gesellschaft, Politik und auch Unternehmen stillgehalten hat. Oder auch, gesellschafts- und systemimmanent den Mund gehalten hat. In bester Absicht, nach gelebter Streitkultur und zur Wahrung von etwas, dass da gutes Klima heißt. Doch ist das wirklich ein gutes Klima für Visionen?
Doch welche Visionen betrifft das?
1.) Der Chef soll Leader sein
Dazu gibt es täglich nette Bildchen im Netz. Lichtgestalten, die ein zartes Pflänzchen gießen, anstatt es plattzutreten. Die Gärten gießen anstatt Wälder zu roden und die natürlich auch vorangehen und mitarbeiten anstatt mit der Peitsche anzutreiben.
Diese Persönlichkeit hat immer Zeit und Ohr für ihre Mitarbeiter, fördert Talente und ist nie strafend, fordernd oder gar rechthaberisch. Stellt sich immer vor sein Team und konsultiert es bei allen wichtigen Fragen. Menschlichkeit steht im Vordergrund von all seinen Handlungen, Entscheidungen und Denken.
Kommt das bekannt vor? Vielleicht auch ein Wiedererkennen vom oberen Teil des Artikels?
Und nun stellen wir uns Konzernstrukturen vor. Die Börsenanalysten hatten – woher auch immer – die Erwartung, dass es im Quartal X eigentlich 0,2% hätte mehr sein können, der Aktienkurs ist Richtung Süden unterwegs, der Aufsichtsrat tagt weil die Anrufe der Investoren zunehmen und es ist „Abendstimmung“ in der „Leaderetage“ des Unternehmens.
Und nun? Wie geht es weiter? Iterative Diskussionsrunden, Workshops und Ideenzirkel bis hinunter auf Arbeitsebene? Weil das ggf. auch noch an etwas lag, was gar nicht beeinflussbar war? Ein Embargo hier, eine Missernte da und dann noch die überraschende Pleite eines Zulieferers in „Outsourceland“?
Das hätte man doch da Oben diskutieren können? Hat man! – Nur ist das letztlich egal, da die Rekapitalisierung am Markt gefährdet ist, die Banken als Kapitalgeber unruhig werden und daher die Investoren (kalkulatorische) Verluste haben, die sie aber real sehen.
Das System tickt so. Und daher kann auch davon ausgegangen werden, dass nach einer sitzungslangen Nacht am nächsten Morgen der Boss vorbeikommt – nicht der Leader. Weil am Ende des Tages das zählt, was in der Bilanz ausgewiesen wird.
Und HR-Kosten sind da als Kosten bilanziert, nicht als Human Ressources – als Guthaben in Wissen, Erfahrung, Können und Idee – an sich. Und da bisher diese Ressource als austauschbare weil omnipotente Überschussressource galt, wurde diese Ressource auch so behandelt. Vom Praktikanten in unterschiedlichen Abstufungen bis hoch zum Aufsichtsratsvorsitzenden.
2.) Der Pool von Fachkräften ist unerschöpflich
Ein paar glückliche Umstände haben dazu geführt, dass der schon in den 90er absehbare demographische Trend dahinging, dass es so nicht ewig weitergehen wird.[2] Die Ein-Kind-Familien und die zunehmende Singlegesellschaft machten das nur zu deutlich. Doch der Wegfall des Kalten Krieges, die Wiedervereinigung und die (damals) noch höhere Geburtenrate bei den Migranten der 60er und 70er Jahre ließen alle Unkenrufe schnell verhallen. Eigentlich bis dato, wo man glaubte, die Flüchtlingskrise im Nahen und Mittleren Osten würde hier Fachkräfte anschwemmen.[3]
Der Diskussion, ob das so ist, ging man aus dem Weg, bis klar wurde, dass es eben nicht so ist. Diese Fachkräfte und Akademiker haben unterschiedliche Ausbildungsstandards. Ein Metallfacharbeiter irakischer Prägung arbeitet gemeinhin anders als ein Facharbeiter hier. Allein die technischen Produktionsverfahren vor Ort sind grundlegend anders. Ergo steht man nun vor der Einsicht, dass ein neuer demographischer Glücksfall nicht eintreffen wird. Zumindest nicht zeitgerecht, um das Großprojekt Digitalisierung zu stemmen. Eigentlich hofft man, dass eben diese den Mangel an Fachkräften auffängt. Personalressourcen ersetzt. Den Personalkostenblock (weiter) senkt…zumindest langfristig.[4]
Das wird mit Sicherheit auch so eintreffen – langfristig im Sinne von lang und fristig.
Lang heisst hier 15-20 Jahre und fristig heisst, dass diese Digitalisierung auch umgesetzt werden muss. Und das eben durch die, die jetzt schon da sind, denn es kommt einerseits nicht (mehr) genügend qualifiziertes Personal nach und andererseits brechen die Geburtenstarken Jahrgänge – auch bei 45 Beitragsjahren – zunehmend schnell weg. Unerschöpflichkeit dieser Ressource heißt hier oft freiwillige Weiterarbeit, Teilzeit im Alter und andere nette Euphemismen umschreiben den Umstand, dass es ohne die „alten Säcke“ eben nicht mehr geht.[5]
Und diese sollen nun, nach den persönlichen Erfahrungen der 80er bis dato, wo sie als austauschbare Überschussreserve galten, die gern zu Kosteneinsparungen herangezogen wurde, eben diese Digitalisierung planen, vorbereiten und umsetzen. Mit denen, die da nachkommen und völlig andere Sichtweisen, Ideen und Visionen von Arbeit haben. Generation X (und Y), „freiwillig“ immer länger arbeitend trifft Generation Z, die bisher allzu oft vollversorgt war.[6]
In diesem Zusammenhang werden in stark diversifizierten Berufsbildern, mit exakt zugeschnittenen und segmentierten Fachausbildungen/Studiengängen Redundanzen schwierig zu gestalten sein. Gerade in interdisziplinären Schnittstellen, die aber in diesen zu digitalisierenden Umfeldern immer wichtiger werden.
Da die nachfolgende Generation aber eher monolinear ausgebildet wurde, kann sie sich diese Schnittstellenkompetenz nur auf der Zeitachse und durch Wissenstransfer via den „Alten“ aneignen. Auch das wird ein zusätzliches Element sein, dass auf diese älteren Mitarbeiter zukommen wird.
Damit wird die Überschussressource Mensch in dem Alter immer wichtiger, wo sie bis dato aus dem Beruf ausgeschieden ist. Und wenn wir an die Frühverrentungen der 90er denken, dann betrachten wir sogar ein Erwerbsalter, das noch nie so hoch war wie schon bald nötig sein wird.
Und das eben nicht nur zur Absicherung des Sozialstaates an sich, sondern gerade auch zum Produktivitätserhalt der Unternehmen.
3.) Eine Corporate Identity wächst mit den Aufgaben von selbst
Damit wird die innerbetriebliche Grundlage des „Gemeinwesens Unternehmen“ zunehmend schwieriger, weil spannungsgeladener. Unterschiedliche – auch generationsbedingte – Ansichten werden aufeinandertreffen. Die Karriereerwartung der Jüngeren, die auf Positionen wollen, die durch Ältere immer länger blockiert werden, weil sie immer länger in Arbeit stehend gebraucht werden, wird ausgebremst.
Karrieremodelle ziehen so nicht mehr und die schon sattsam bekannten Rollentitulierungen von Junior Specialist bis Executive Senior Vice President sind nicht wirklich förderlich, zumal sie auch immer öfters an den Erwartungen der jungen Generation vorbeigehen, die eher arbeitet um zu leben anstatt leben um zu arbeiten. Und wie Letzteres aussieht, sehen sie dann täglich an der Arbeit, wenn sie mit Karl-Heinz, Helga, Anton und Erna zusammenarbeiten.[7]
Es wird klar, dass diese Unternehmensgemeinschaft sich verändern, sich anpassen wird müssen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Wer hat schon wirklich hinterfragt, was die Belegschaft will, erwartet und letztlich auch braucht.
CI war bisher ein Vertriebskonzept zur einheitlichen Kommunikation mit dem Markt, den Partnern und allen anderen Externen.
Dass CI auch zunehmend nach innen wichtig wird, wurde spätestens beim Employer Branding[8] klar, wurde über das Personalmarketing weitergeführt und hat auch das Recruiting[9] erreicht. Die Branche überschlägt sich dazu geradezu, da in Zeiten von Fachkräftemangel, der gern auch zur Beruhigung aller bestritten wird, die Personalgewinnungskosten in Verbindung mit immer längeren Vakanzkosten zunehmend steigen.
Spätestens hier ist das Bild der austauschbaren Überschussressource Fachkraft ad absurdum geführt. Es kratzt aber argumentativ das gewohnte Bild an…
Das in diesem Zusammenhang die CI nach innen genau die gestalterische Kraft braucht, wie der Part nach außen hin, ist daher zwangsläufig. Bloß wird es schwer sein hier einen Top-Down-Ansatz zu gestalten, da diese CI die Belegschaft abholen, integrieren und wertschätzen soll. Drei Begrifflichkeiten, die in den 90er Jahren völlig unbekannt, zumindest nicht gerade nachdrücklich verfolgt wurden, wenn man von Belegschaft sprach.[10]
Ein Bottom-Up-Ansatz trifft aber genau auf die Kultur, die wenig gepflegt, misstrauisch beäugt und dann auch gern rhetorisch-euphemistisch ausgesessen wurde:
die Streitkultur…
4.) Der gute Mitarbeiter
Jeder Mensch ist anders. Hat andere Fähigkeiten, ein anderes Wissen und eine andere Erfahrung und bildet so im Laufe der Jahre unterschiedlich Charaktere aus. Das macht eine pluralistische Gesellschaft erst aus, die nach Dahrendorf im Streit wachsen kann.
Das schließt nicht aus, dass daraus auch gute Mitarbeiter, tolle Kollegen und unverzichtliche Leistungsträger erwachsen, aber es schließt schon theoretisch aus, dass eben ALLE so werden.
Wir alle kennen die 10/70/20-Prozentregel.
Zehn Prozent in einem Unternehmen sind absolut unverzichtbare Leistungsträger, 70 Prozent machen ihren Job und 20 Prozent sind die, über die dann keiner mehr spricht, weil es Streit geben könnte, wenn man es tut. Das ist der personaltechnische Bodensatz, den jeder kennt. 08/15-Personal. Keine Gelegenheit zur Abwesenheit auslassend, acht Uhr kommen, bis 15 Uhr die Zeit totschlagen und sich dann auf den ersehnten Feierabend vorbereiten.
Das Problem: in aller Regel nutzen diese Leute die Zeit dafür sich gut zu vernetzen, sich gegenseitig zu decken und dafür zu sorgen, dass sie nicht allein sind.
Und das trifft dann auf das Thema Streitkultur:
Führungskraft/Leader vs. Stimmung/Betriebsrat.
Studien gehen dahin, dass der untere Anteil der Belegschaft diese insgesamt mehr beeinflusst, als es die oberen zehn Prozent je schaffen könnten. Zumindest in Umfeldern, wo Stillschweigen die gemeinschaftliche Kritik an falschem Verhalten ersetzt.
Und dieses gemeinschaftliche Verhalten setzt dann auch an der Begrifflichkeit des guten Mitarbeiters an. Müssen 80 Prozent diese 20 Prozent tolerieren? Ist das gut?
Für wen?
Wenn Mitarbeiter bis 63, 67 oder X arbeiten müssen, dann müssen solche Themen auch angesprochen werden. Offen. Denn jeder ältere Mitarbeiter wird irgendwann an die Grenze dessen kommen, was er dann zu leisten vermag. Physisch, psychisch aber auch physiologisch. Das ist natürlich bedingt und hat nichts mit Mutwilligkeit zu tun. Nur sobald (nicht wenn!) es eintrifft, dann muss er eine Umgebung vorfinden, wo er das offen ansprechen kann.
Fehlt diese Möglichkeit, dann wird der „Bodensatz“ größer. Ungewollt, aber stetig.[11]
Daher definiert sich guter Mitarbeiter nicht so sehr an dem, was er leistet – wie er preformed – sondern eher daran, wie er mit den Schwächen seiner Umgebung und den seinen umgeht, umgehen kann.
Und hier ist dann nicht nur die CI und das „Leadership“ gefragt, sondern auch das Wissen um die Veränderlichkeit der Dinge im Alter und die Tendenz eben solchen Konflikten aus dem Weg gehen zu wollen.
Aber auch das ist Teil von guten Mitarbeitern bis hinauf zum Chef/ Boss/ Leader.
5.) Zu seinen Fehlern stehen
Eine Forderung, die gern, laut und immer wieder verlangt wird. Eher sogar gefordert wird. Hört sich auch logisch an. Und die Vision von einer Welt, wo Fehler zugegeben werden und alle dann bestrebt sind diese gemeinschaftlich auszubügeln ist auch etwas, was jeder sofort bejahen würde. Es geht nur leider an der Realität vorbei.
Denn einen Schuldigen zu haben, vermeidet Streit. Dieser würde vermutlich dafür sorgen, dass alle Schwachstellen kommuniziert und damit erkannt werden, aber einen bekennenden Schuldigen zu haben vermeidet diese unangenehme Situation.
Im günstigsten Fall fühlt sich jeder betroffen und man startet einen von Grund auf neuen Ansatz. Mitunter aber erst dann, wenn der Verursacher eine andere Tätigkeit gefunden hat – aus Betroffenheit heraus.
Fehler eingestehen soll jeder, doch eine Fehlerkultur ist eher seltener.
Allein das Wort „Fehlerkultur“ sagt schon einiges darüber aus, wie es um den Vorgang an sich steht. Daher widerspricht diese Forderung der Realität auf allen Ebenen und in jeder (auch akademischen) Sichtweise.
Fehler eingestehen zu können ist ein Output der Streitkultur. Der Fähigkeit in einer Gemeinschaft einen Streit zu führen, einen Konflikt objektiv auszutragen und dabei erkannte Fehler zu beseitigen. Dass es dabei „menschelt“ ist genauso real wie die Möglichkeit dieses „Menscheln“ nicht als Abbruchkriterium zu sehen. Doch dazu bedarf es der Übung. Und diese Übung ist der guten Atmosphäre gewichen, die darüber hinaus oft mit Bequemlichkeit angereichert ist.
Und dort einen Schuldigen zu haben, ist einfach, konfliktneutral und entspannend.
Und spätestens dann, wenn man beim Fehlerzugeben der Leidtragende war, lernt der Mensch auch aus seinen Fehlern: er macht es nie wieder!! Und andere, die das erlebt haben, auch nicht.
QED…
FAZIT – Kultiviertes Streiten und Konfliktelösen
Es gibt eine Menge schlüssige Visionen des zukünftigen Miteinanders im Unternehmen, in der Wirtschaft aber auch in der Gesellschaft. Jede dieser o.a. Visionen, Ideen oder Gedanken sind richtig, wichtig und könnten funktionieren, wenn man von einem elysischen Optimum ausgeht.
Leider ist dieses Optimum selten anzutreffen und die Prämissen sind allzu oft nicht gegeben. Diesen wird aber auch nicht widersprochen, und wenn doch, dann so leise, zurückhaltend und auf allgemeinen Frieden bedacht, dass die Vision schnell als Lösung erscheint.
Eine fehlende Streitkultur, bis hin zur Unfähigkeit Konflikte konform und gewinnbringend austragen zu können, und das systemische und institutionalisierte Wegsehen werden in den kommenden Jahren dazu erheblich beitragen, dass aufkommende Generationskonflikte in den Unternehmen zunehmen werden.
Fragen von Arbeitsgerechtigkeit (in jeder Hinsicht!), der Umsetzung von Zukunftstechnologien und der Frage an sich, was Arbeit bis ins Alter wert sein wird, werden uns in allen Bereichen begleiten.[12]
Die gemeinsame Basis im Unternehmen, umschlossen von einer Corporate Identity, wird hier hierbei ein wesentlicher Bestandteil dessen sein, wie, durch wen, wie schnell und hinreichend Lösungen gemeinverträglich und einhellig generiert werden können. Und das auch hinsichtlich eines Images, das dem Unternehmen in den Personalmarkt hinein als Arbeitgebermarke bei der Akquise von neuen Talenten hilfreich ist.
Die Future Workforce Planning wird nicht unerheblich davon (mit)getragen werden.[13]
Eine fehlende Streitkultur mit dogmatisch vorgetragenen Visionen ohne reale Basis und mit Prämissen, die oft schlicht nicht existent sind, werden zunehmend erfolgskritisch. Die geförderte Toleranz durch Schweigen und die Förderung derer, die erkannt haben durch Nichtstun und Schweigen zumindest keine Nachteile zu haben, sind dieser neuen notwendigen Kultur nicht förderlich.
Gerade dann nicht, wenn Arbeit in alternden Belegschaften auch an altersmäßige Grenzen stoßen wird, die zur Aufrechterhaltung der Produktivität und damit des Unternehmenserfolgs nicht zu überschreiten sind.[14]
Die Ausgestaltung des demographischen Wandels und der Digitalisierung im Unternehmen wird parallel verlaufen und von den Ideen und Visionen aller abhängig sein; gerade dann, wenn es um tragfähige Prämissen für das umfassende Changeprojekt geht. Hier ist das Wissen und die Erfahrung aller Prozessbeteiligter erforderlich, die aber einer tragbaren Plattform bedürfen, auf der offen, objektiv und neutral – gern aber auch konfrontativ – argumentiert werden kann.[15]
Die Zeiten, wo alles ging, der Himmel die Grenze war sind politisch, gesellschaftlich aber auch im Unternehmen vorbei, da die auf uns zukommenden Probleme (nicht neudeutsch: Herausforderungen!) zu gravierend sind.
Packen wir’s an und streiten!
Quellenverzeichnis:
[1] Vgl.: Future Business Consulting: Definition Joint Future Work (2014);
Vgl.: Sascha Rauschenberger: Joint Future Work – Ein strategisches Gesamtkonzept für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik im demographischen Wandel (2015)
[2] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Future Work und Megatrends – Herausforderungen und Lösungsansätze für die Arbeitswelt der Zukunft: Ein Kompendium zum demographischen Wandel; Windsor-Verlag 2014
[3] Anm.: 2016 wurde dieser Artikel kontrovers diskutiert, ist aber inzwischen mehrfach zitiert worden und von den neuen aktuellen Forderungen aus Gesellschaft und Politik fast schon „überrollt“. Mitte 2016 war das aber eine „Vision“ mit Alleinstellungsmerkmal…
Vgl.: Sascha Rauschenberger: E-Paper: Joint Future Work und Fehlermöglichkeiten in der Digitalisierung – Teil 2: Migranten und Qualifikation, Conplore Magazin (2016)
[4] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Demografischer Wandel und Future Work: Eine gesellschaftliche Herausforderung für den Arbeitsmarkt der Zukunft, Conplore Magazin (2014)
[5] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Joint Future Work – Ein Tsunami verändert die Arbeitswelt der Zukunft, Conplore Magazin (2015)
[6] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Future Work und Social Media: Die ‚digital native‘ Generation Y und Z – Chance und Risiko, (2014)
[7] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Future Work und Megatrends – Herausforderungen und Lösungsansätze für die Arbeitswelt der Zukunft: Ein Kompendium zum demographischen Wandel; Thema 1.2 Konfliktpotentiale in der Future Work S. 18-53, Windsor-Verlag (2014)
[8] Vgl.: Sascha Rauschenberger: CI für HR: Marketing für das Recruiting, bei: Conplore Magazin (2014);
Vgl.: Norbert Rohloff / Sascha Rauschenberger: Joint Future Work und Marketing: Die Gefahren einer getrennten Vertriebs- und Personalstrategie für Umsatz und Personalbedarfsdeckung, Conplore Magazin (2015)
[9] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Future Recruiting: Die Dimensionen des „War for Talents“ in der Arbeitswelt der Zukunft, Conplore Magazin (2014);
Vgl.: Sascha Rauschenberger: JOINT FUTURE WORK und das Future Recruiting Teil 2:
Neue Instrumente für neue Wege in sich verändernden Zeiten, Conplore Magazin (2016)
[10] Vgl.: Dr. Achim Wortmann / Sascha Rauschenberger: Sechs Fragen, wie Future Workforce Planning das Employer Branding stärken kann, Conplore Magazin (2016)
[11] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Future Work: die Arbeitswelt der Zukunft und die Hürde Gesundheitsvorsorge, Conplore Magazin (2014)
Dazu auch ein anderer Gedanke:
Vgl.: Sascha Rauschenberger: Future Work und die vernachlässigten Ressourcen im Arbeitsmarkt der Zukunft, Conplore Magazin (2014)
[12] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Demografischer Wandel und Future Work: Kostendruck für die Wirtschaft
[13] Vgl.: Dr. Achim Wortmann / Sascha Rauschenberger: JOINT FUTURE WORK und Workforce Analysis -die Basis für erfolgreiches Future Workforce Planning, Conplore Magazin (2016)
[14] Vgl.: Sascha Rauschenberger: Future Work und Megatrends – Herausforderungen und Lösungsansätze für die Arbeitswelt der Zukunft: Ein Kompendium zum demographischen Wandel; Thema 1.2 Konfliktpotentiale in der Future Work S. 18-53, Windsor-Verlag (2014)
[15] Future Business Consulting: Future Workforce Planning und 12 beliebte Stolpersteine (2015)
Bildquelle: Anastasia Malkhazova: Bazon Brock; Öl auf präpariertem Papier, 210 x 160 cm, 2015; www.anastasiamalkhazova.com